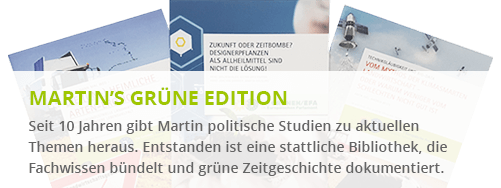Tagesgespräch mit Martin Häusling (Grüne): Artensterben mindestens so schlimm wie Klimawandel
aus der Sendung vom Fr., 27.10.2023 18:05 Uhr, SWR2 Aktuell, SWR2 , Jenny Beyen
Weltweit: Die Zockerei mit Getreidepreisen | WDR für Das Erste
An der Hauptstraße nach Nouakchott sitzt sie und siebt Weizen aus dem Sand – jeden Tag. Was hier liegt, weht der Wind von den LKW. Fatimetou ist eine von vielen Frauen, die so ihren Unterhalt bestreiten. In einem Land, in dem Lebensmittelkosten den Großteil des Einkommens ausmachen, ist jedes Weizenkorn wertvoll. Auch Fatimetou merkt, dass alles plötzlich mehr kostet. Warum aber und wer dahinter steckt, das wisse sie nicht, sagt sie.
Mauretanien ist abhängig von Getreide aus dem Ausland. Wenn die Lieferungen ausbleiben, dann steigt der Preis. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Denn eigentlich wird weltweit genug Weizen produziert. Doch der Rohstoff ist zum Spekulationsobjekt geworden.
Getreide – ein Spekulationsgeschäft
Paris. Hier sitzt die wichtigste Handelsbörse für Weizen in Europa: Euronext. Neben der Rohstoffbörse in Chicago die weltweit größte und wichtigste. Ein Teil der Ernte wird hier gehandelt: Dabei sichern Getreidehändler ihre millionenschweren Weizen-Lieferungen mit Termingeschäften ab, sogenannten Futures.
Lange vor der Ernte verkaufen Landwirte ihre Ware und garantieren die Lieferung einer bestimmten Menge. Händler kaufen für einen fixen Preis und übernehmen so das Risiko einer schlechten Ernte. Steigt der Preis in der Zeit bis zum Fälligkeitstermin, profitiert der Investor. Sinkt er, erhalten die Landwirte dennoch den vereinbarten Preis – eine Art Versicherung. Und normalerweise ein Win-Win-Geschäft für alle Seiten. In Krisenzeiten aber setzen Investoren und Spekulanten auf stark steigende Kurse und treiben mit Milliardensummen den Preis in Rekordhöhen.
Zu diesem Ergebnis kommt die Investigativ-Journalistin Margot Gibbs. Mit einem internationalen Team hat sie Daten analysiert, um zu verstehen, warum sich der Weizenpreis bei Kriegsbeginn innerhalb weniger Wochen verdoppelte. Offenbar pumpten Investoren große Mengen Geld in den Markt. Aber wer? Die meisten Käufer blieben anonym. Lediglich für zwei börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs, konnte Gibbs‘ Team massive Investitionen nachweisen.
"Wir haben herausgefunden, dass die beiden größten Agrar-ETFs in den ersten vier Monaten 2022 für 1,2 Mrd. Dollar Weizen-Futures gekauft haben – verglichen mit 197 Millionen für das gesamte Jahr 2021. Das war sehr auffällig", erzählt die Investigativ-Journalistin. Dass innerhalb kürzester Zeit viel Geld in die Märkte fließt, ließ sich zuvor bereits bei der Finanzkrise und der Schuldenkrise beobachten. Das Problem: Danach sank der Preis nie wieder ganz auf Vor-Krisen-Niveau. Mit drastischen Folgen für die betroffenen Länder. Im Sommer 2022 verschärfte sich die Lage in Mauretanien dramatisch.
Eingriff zwingend notwendig
Mamadou Sall ist verantwortlich für die Lebensmittel-Beschaffung beim World Food Programme. Hunderttausende sind vom Hunger bedroht. Hier gibt es Probleme mit dem Nachschub. Aber nicht, weil der Weizen fehlt, sondern das Geld. Die Auswirkungen von Krieg und überhöhten Weltmarktpreisen – so sehen sie aus: "Die größte Herausforderung ist, dass wir mit den Spenden, die wir bekommen, immer weniger Hilfsgüter einkaufen können. Für das Geld, mit dem wir früher 100 Tonnen Weizen bezahlen konnten, bekommen wir bei den derzeitigen Preisen nur noch fünfzig Tonnen. Und die Auswirkungen für die Hilfsbedürftigen sind massiv."
Um genau solche Fehlentwicklungen künftig zu verhindern, gab es bereits nach der letzten Ernährungskrise 2011 Rufe nach staatlicher Regulierung. "Eine ganze Reihe von Leuten hat sich zu Wort gemeldet, einige sogar aus der Branche und sagten: Dieser Markt ist kaputt. Er folgt kaum noch den Grundsätzen von Angebot und Nachfrage. Er ist eine reine Wettbude", sagt Margot Gibbs. Doch sämtliche Regulierungsversuche verliefen weitgehend im Sande.
Im Haushaltsausschuss des EU-Parlamentes saß auch damals schon Martin Häusling. Er kann sich noch gut an die Debatten der vergangenen Jahre erinnern. Die Diskussion war am gleichen Punkt wie heute. Für den gelernten Bio-Landwirt sind deshalb auch die Forderungen noch die gleichen wie damals. "Wir müssen als erstes eine Spekulations-Bremse einziehen, wenn wir merken, da wird offensichtlich darauf spekuliert, dass der Preis steigt. Da muss die Politik eingreifen können und den Preis müssen wir dämpfen."
Große Konzerne mit zu viel Macht
Doch das Problem reicht tiefer. Ein Grund für die Einladung zur Spekulation in Krisenzeiten liegt in der globalen Marktkonzentration: Fünf internationale Agrarkonzerne teilen sich untereinander drei Viertel des Welthandels an Agrarrohstoffen. Es sind die sogenannten ABCD-Konzerne: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill und Louis Dreyfus. Zusammen mit dem chinesischen Agrargigant Cofco bilden sie die "Big Five", die Großen Fünf. Wie viele Millionen Tonnen Weizen in ihren Lagern wartet, ist Geschäftsgeheimnis. Zu einer Veröffentlichung sind sie nicht verpflichtet. Eine Einladung für Spekulanten.
"Ja, wir müssen uns überlegen, wie wir die Macht sozusagen von diesen großen Konzernen auch ein Stück weit eindämmen. Dass wir sehen, dass die nicht das ganze Geschäft übernehmen, sondern dass wir zum Beispiel auch dafür sorgen, größere Reserven in staatlicher Hand zu haben", sagt Martin Häusling.
Passiert nichts, dann bleibt der lebenswichtige Rohstoff Weizen Spekulationsobjekt und Druckmittel im politischen Poker: Nach dem Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine fiel der Weizenpreis. Doch in wenigen Tagen läuft das Abkommen aus. "Die Gefahr ist, wenn das Getreideabkommen nicht verlängert wird, dann stehen wir tatsächlich wieder vor der Frage: Wie kommt das ukrainische Getreide auf die Märkte? Und dazu haben wir noch das Problem, dass irgendeine Handelsroute geschlossen ist, die Spekulationen anfangen und der Getreidepreise durch die Decke geht", erklärt Häusling weiter.
Doch selbst wenn weiterhin ukrainische Weizenschiffe ablegen können, die nächste globale Krise wird kommen – ob Krieg, Naturkatastrophen, Epidemien – und mit ihr die Spekulation.
Autor:innen: Tatjana Mischke / Martin Herzog
Stand: 05.03.2023 19:12 Uhr
13.02.2023 #global2000 #lebensmittelsicherheit
Über 420.000 Menschen fordern europaweit: Neue Gentechnik (NGT) in Lebensmitteln auch weiterhin regulieren und kennzeichnen. #ichooseGMOfree - Mit unserem Essen spielt man nicht!
Strenge Risikoprüfung und Kennzeichnung für #NeueGentechnik sichern! Volle Unterstützung für unsere Kolleg:innen, die in Brüssel die Petition, inkl. unserer #PickerlDrauf-Unterschriften, an die Europäische Kommission überreichen!
Eine breites Bündnis von mehr als 50 Organisationen aus 17 EU-Mitgliedstaaten hat eine Petition an die Europäische Kommission gerichtet, in der wir fordern, dass Neue Gentechnik-Pflanzen auch reguliert und gekennzeichnet bleiben.
Danke an alle, die sich hinter unsere Forderungen gestellt haben und sich für die Wahlfreiheit der Bäuerinnen und Bauern und Konsument:innen einsetzen!

"One-Health-Ansatz ernst nehmen: Wege zu weniger Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung"
von Martin Häusling
Antibiotikaresistenzen sind weltweit auf dem Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt die steigende Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika eine »globale Bedrohung« für die menschliche Gesundheit, an der jährlich weltweit bereits über eine Million Menschen sterben, Tendenz steigend. Zwar fördert jeder Einsatz von Antibiotika die Bildung von Resistenzen, ihre Entstehung kann aber verlangsamt werden, und da muss nach Ansicht des Autors des folgenden Beitrages dringend angesetzt werden – in der Humanmedizin, aber auch in der Veterinärmedizin, die im Fokus des Beitrages steht. Als notwendige und machbare Schritte, um den Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung zu reduzieren, werden beispielsweise Änderungen an den Tierhaltungssystemen, an der Fütterung oder der Zucht genannt. Besonderer Handlungsdruck besteht beim Umgang mit den sog. Reserveantibiotika.
Zwei große Krisen der Biosphäre sind es mindestens, die keine Zweifel daran lassen, dass gehandelt werden muss. Verheerende Dürren und Waldbrände, immer neue Rekordtemperaturen, Wasserknappheit oder wahre Sturzfluten sind offensichtliche Boten der menschengemachten Klimakatastrophe und mahnen zur Umkehr und Einhaltung international vereinbarter Klimaziele. Doch parallel und angefacht und betroffen davon geht es auch der Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten an den Kragen. Man spricht vom sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Und das ist womöglich bedrohlicher als die Klimakatastrophe.
In diesem Dossier steht, woran es (auch) liegt: An der Art, wie wir mit dem Land umgehen, wie wir es bewirtschaften. Deshalb gerät unweigerlich die Landwirtschaft in den Fokus, denn sie ist nach wie vor einer der Hauptkiller der Artenvielfalt. Unsere Felder und Wiesen, aber auch unsere Moore und Wälder sind kaum noch Lebensraum und Rückzugsort einer bunten Vielfalt des Lebens. Insekten und Vögel dienen uns als Indikatoren. Doch das Tirilieren, Gesumme und Gebrumme haben drastisch abgenommen. Das Übermaß von Stickstoff und Pestiziden als enorme Belastung der Ökosysteme, ein Kahlschlag der Landschaft auch an Strukturen, der Umgang mit unseren Böden und eine weitere Intensivierung fordern ihren tödlichen Tribut.
Doch zeigen Beispiele, dass es anders geht, wenn man nur will. Und das soll uns Mut machen, gegen die nach unten weisenden „Bestandskurven des Grauens“ anzugehen und umzusteuern. Auch hier ist es nachzulesen.

Die von Martin Häusling und der grünen Fraktion im Europaparlament, Greens/EFA, herausgegebene Publikationsreihe ist ein Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion rund um das Thema „Welche Landwirtschafts- und Ernährungspolitik wollen wir in Zukunft haben?“. Die Publikationsreihe enthält Studien und Dossiers von Wissenschaftlern, Fachexperten und Journalisten.
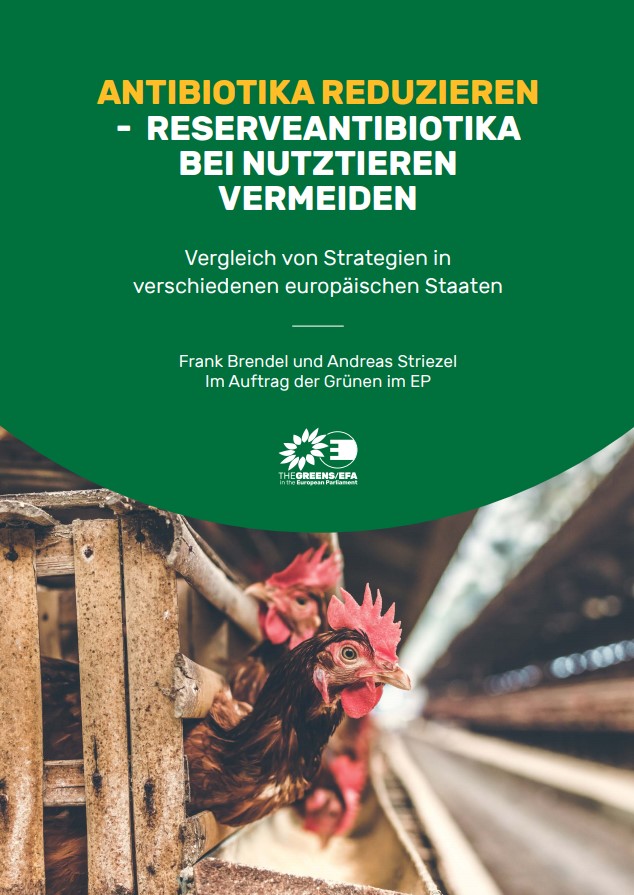
ANTIBIOTIKA REDUZIEREN - RESERVEANTIBIOTIKA BEI NUTZTIEREN VERMEIDEN
Vergleich von Strategien in verschiedenen europäischen Staaten
Frank Brendel und Andreas Striezel
Im Auftrag der Grünen im EP
English Version
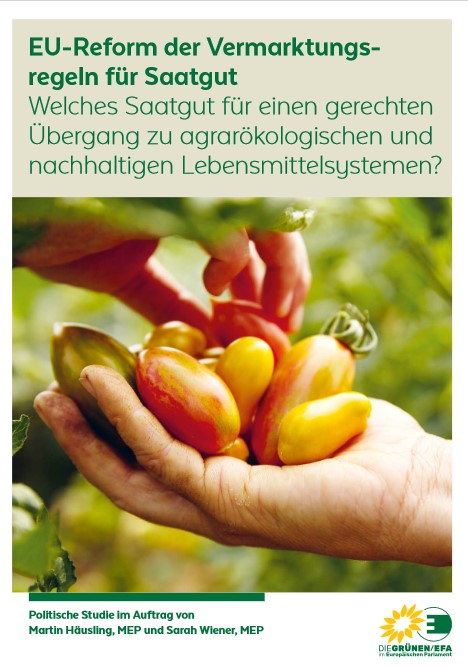
Zugelassene Sorten für unsere Lebensmittelproduktion unterscheiden sich heutzutage häufig nur noch in geringfügigen Ausprägungen und sind einseitig auf Leistung gezüchtet. Das ist fatal, denn Sortenvielfalt ist notwendig, wenn wir unsere Agrarsysteme zukunftssicher aufstellen wollen.
In der EU gibt es 27 verschiedene Saatgutvermarktungsregelungen, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. Der letzte EU-Vorschlag für eine Saatgutreform 2013 war allerdings völlig unzureichend, um die Saatgutvielfalt auf unseren Äckern und in unseren Gärten zu stärken. Der Vorschlag hätte den Erhalt und die Nutzung der Artenvielfalt in der Landwirtschaft und im Gartenbau nicht befördert, sondern weiterhin uniformem, auf Ertrag gezüchtetem Einheitssaatgut den Vorrang am Markt gegeben. Die Zucht und Vermarktung angepasster robuster Sorten ist aktuell nur unter den Regeln des Öko-Rechtes möglich.
Die EU-Kommission plant ihren Vorschlag zur Novellierung des bestehenden Saatgutrechts am 6. Juni 2023 vorzulegen.
Greens/EFA fordern die Kommission auf, eine grundlegende Reform vorzulegen, die ein neues Gleichgewicht zwischen der industriellen Pflanzenproduktion und lokalen und weniger inputabhängigen Produktionssystemen wie der agrarökologischen und ökologischen Produktion herstellt.
Die Studie „Welches Saatgut für einen gerechten Übergang zu agrarökologischen und nachhaltigen Lebensmittelsystemen?“ (Deutsche Version
/ english version )